|
(Abbildungen in Arbeit)
SCHATTEN-SPIELE
Stichworte zu einem Vortrag an der Universität
Graz 1999.
Erschienen in: Schwarz. Sein oder Nicht-Sein.
Kunsthistorisches Jahrbuch Graz, Band 28, Graz 2004, S.176-186
Ob man Schwarz für eine besondere oder eine normale Farbe hält,
hängt vom jeweiligen historischen Verständnis ab. Kunsthistoriker
tendieren dazu, es als Unfarbe zu denunzieren. Das hängt damit
zusammen, dass erst seit dem 20. Jahrhundert die Emanzipation des Schwarz
als eigenständiger Farbe eingesetzt hat. In der neuzeitlichen Malerei
war Schwarz das Medium der Darstellung von Lichtverhältnissen.
Im Hell-Dunkel diente es als Darstellung der in die Dunkelheit übergehenden
Schatten.
In der folgenden halben Stunde möchte ich über das neue Interesse
am Schatten referieren und inwiefern das für das Verständnis
der neueren und neuesten Kunst von Interesse sein kann. Drei berühmte
Kunsthistoriker haben in den letzten Jahren Bücher zu diesem Thema
veröffentlicht: Ernst Gombrich 1995 (deutsch: SCHATTEN. Ihre
Darstellung in der abendländischen Kunst, Berlin 1996), der
immerhin einen De Chirico von 1914 anbietet, Michael Baxandall 1995
(Löcher im Licht. Der Schatten und die Aufklärung,
München 1998), der zwar nicht in den künstlerischen Beispielen,
aber in der Berücksichtigung der Wahrnehmungstheorie innovativ
ist, und Victor Stoichita 1997 (A Short History of the Shadow,
deutsch: Eine kurze Geschichte des Schattens, 1999), der immerhin
bis zu Malewitsch, Picasso, Duchamp, Beuys, Warhol und Boltanski, also
praktisch in die Gegenwart gelangt. Diese Bücher haben unmittelbar
eine breite Resonanz erfahren und stehen in einem weiteren Zusammenhang.
Der Schatten ist keine Selbstverständlichkeit: Jean Piaget hat
1927 herausgefunden, dass er von Kindern erst ab einem bestimmten Alter
(damals 9) als etwas nicht unmittelbar mit dem Körper Zusammenhängendes
verstanden wird, das mit Licht und Raum zu tun hat. Er diente in der
perspektivischen Konstruktion der Wirklichkeit als ein zentrales Argument,
das freilich immer wieder durchbrochen worden ist.

Konrad Witz: Anbetung der Könige, 1444 (Kunstmuseum
Genf, Abb. links)

Das Kind auf dem Schoß Mariens blickt nach rechts aus dem Bild,
doch sein Schatten wendet sich dem knieenden ersten König zu und
segnet diesen (vgl. Detail, Abb. rechts). Die Sprache des Körpers
und die Zeichnung des Lichtes (wörtlich: Fotografie!) gehorchen
manchmal nicht den gleichen Regeln, indem sie mehr erzählen als
in der Realität sichtbar ist.

Agostino Veneziano: Die Akademie des Baccio Bandinelli,
1531 (Abb. links)
Die Handhaltungen der Akademielehrer und –schüler sind befangen
in ihren Tätigkeiten des Kopierens und sich nach Normen orientierenden
Gestaltens. Ausgerechnet die Venusgestalt, die einer nahe am Licht hält,
wirft keinen Schatten – wie zum Ausgleich erhebt die mittlere der
drei Grazien auf dem Bord im Hintergrund ihren rechten Arm, wenn auch
nur als Schatten. Es sind die Schatten, die hier aus der Statuarik ausbrechen,
um in ein Gespräch einzutreten. Auch der rechte, würdig wirkende
ältere Herr mit der Kappe wird im Schatten zu einem Clown, zu einer
Art Hofnarren. Hier ist es der Kontrast von Körperhaltungen und
intendierten Handlungen, die Übersteigerung, die sich von der äußeren
Diszipliniertheit abhebt, die ein Merkmal manieristischer Weltsicht
wird.

Otto van Veen: Amoris umbra invidia
(Neid als Schatten Amors).
Aus: Amorum Emblemata, 1608
Der Schatten kann Widersprüchliches zeigen, weil er auf der Kehrseite
des Lichtes liegt. Mit ihm lässt sich auch moralisch demonstrieren,
dass im Licht der Liebe der Schatten des Neides nicht zu übersehen
ist.

Joseph-Benoît Suvée: Dibutades oder die
Erfindung der Zeichen-Kunst, Brügge, Groeningemuseum
Bartolomé Esteban Murillo: Die Erfindung
der Malkunst, ca.1670
 Das
oft diskutierte Bild zeigt natürlich nicht die Szene aus dem 35.
Buch der Naturgeschichte des Plinius. Dort beschreibt der antike Autor
die Geschichte vom Ursprung der Malerei, wie die Tochter des Töpfers
Dibutades aus der Nähe von Korinth den Schatten ihres in die Fremde
ziehenden und nicht mehr zurückkehrenden Geliebten auf einer Wand
nachzeichnet. Murillo denkt zwar an derartige Geschichten, aber seine
Szene mit mehreren Männern findet im Freien statt. Ich verweise
nur auf zwei merkwürdige Umstände, erstens geben die Schatten
keine Haare, sondern nur die Kopfformen # wieder, zweitens wirft der
Gezeichnete zwei Schatten, als ob eine doppelte Lichtquelle auf ihn
fällt. Auf der Kartusche ist folgendes zu lesen: TUBO DE LA SOMBRA
ORIGEN LA QUE ADMIRAS HERMOSURA EN LA CELEBRE PINTURA (frei übersetzt:
Vom Schatten rührt die Schönheit her, die Du in dem berühmten
Gemälde bewunderst.) Dem Maler geht es offenbar darum, zu zeigen,
dass trotz der Brüchigkeit der ruinösen Hauswand die Schönheit
in dieser Welt des Schattens begründet liegt. Das
oft diskutierte Bild zeigt natürlich nicht die Szene aus dem 35.
Buch der Naturgeschichte des Plinius. Dort beschreibt der antike Autor
die Geschichte vom Ursprung der Malerei, wie die Tochter des Töpfers
Dibutades aus der Nähe von Korinth den Schatten ihres in die Fremde
ziehenden und nicht mehr zurückkehrenden Geliebten auf einer Wand
nachzeichnet. Murillo denkt zwar an derartige Geschichten, aber seine
Szene mit mehreren Männern findet im Freien statt. Ich verweise
nur auf zwei merkwürdige Umstände, erstens geben die Schatten
keine Haare, sondern nur die Kopfformen # wieder, zweitens wirft der
Gezeichnete zwei Schatten, als ob eine doppelte Lichtquelle auf ihn
fällt. Auf der Kartusche ist folgendes zu lesen: TUBO DE LA SOMBRA
ORIGEN LA QUE ADMIRAS HERMOSURA EN LA CELEBRE PINTURA (frei übersetzt:
Vom Schatten rührt die Schönheit her, die Du in dem berühmten
Gemälde bewunderst.) Dem Maler geht es offenbar darum, zu zeigen,
dass trotz der Brüchigkeit der ruinösen Hauswand die Schönheit
in dieser Welt des Schattens begründet liegt.
Im 19. Jahrhundert verselbständigt sich der Schatten auf vielfältige
Weise, indem er nicht mehr auf die Vergangenheit des Ursprungs oder
die Gegenwart des äußeren Raumes verweist, sondern in der
Romantik eines Peter Schlemihl (Adalbert von Chamisso, 1814)
vom Körper lösbar wird, oder zur dunklen Seite eines seelischen
Innenraumes eines verzweifelten Menschen werden kann, wie bei:

Johann H.W. Tischbein: Der lange Schatten, 1805
(zuletzt in der Frankfurter Ausstellung Innenleben zu sehen)
zur ständigen Anwesenheit des im Bild nicht Darstellbaren:

Jean-Leon Gérôme: Golgatha: „consummatum
est“ (1867)
... oder in die Zukunft verweist, wie sie sich der Mutter Gottes in
der Werkstatt des Zimmermanns als Kreuzigung ihres Sohnes zeigt:
 
William Holman Hunt: Der Schatten des Todes, 1873.
(Abb. links)
Die Moderne hat immer wieder ein gebrochenes, nämlich antinaturalistisches
Verhältnis zum Schatten gehabt, mag der Schatten des Nagels in
dem kubistischen Bild Geige und Palette von Georges Braque (1909,
Abb. rechts) auch den Betrachter nachdrücklich darauf aufmerksam
gemacht haben, dass das Bild kein Fenster mehr in eine andere Wirklichkeit
sein soll, sondern die Oberfläche selbst ein ästhetisches
Feld wird.
Die drei folgenden Bilder zeigen die Möglichkeiten einer Verselbständigung
des Schattens auf, die auf andere Realitäten verweisen, auf eine
psychologisch-bedrohliche bei:

Edvard Munch: Pubertät, 1893 (Abb. links)
auf eine soziale Entfremdung bei:
Christian Schad: Bildnis Dr. Haustein, 1928 (Abb. rechts)
Der Künstler selbst hat darauf hingewiesen, dass er in diesem dreifingrigen
Schreckensgespenst mit Blähkopf keine Vorahnung des Selbstmordes
des von der Gestapo bedrohten Berliner Arztes und Salonlöwen gemalt
hat, sondern dass es sich dabei um seine damalige Freundin Sonja (ebenfalls
1928) gehandelt habe. Im Profil ist der Schatten immer der oder das
Andere, wogegen das frontale Spiegelbild das Ich zeigt. Es geht hierbei
um die bedrohlich empfundene Beziehung der Geschlechter und weniger
um die Überraschung, dass ein Schatten vielleicht gar nichts mit
dem zu tun hat, der ihn wirft:

Rene Magritte: Das Prinzip der Unsicherheit, 1944
Der surrealistische Effekt liegt darin, dass in der Wirklichkeit der
Schatten einen Rückschluss auf den Körper erlaubt, durch den
er als Mangel (an Licht) überhaupt entsteht. Der Schatten ist zwar
etwas, insofern er gesehen werden kann, er ist aber auch weniger, weil
er anzeigt, dass der Körper ein Hindernis für das auf ihn
geworfene Licht darstellt. Der Schatten ist in jedem Fall ein Zeichen
der Gegenwart - wenn man sich denn auf ihn verlassen kann. Diese Frau
kann sich auf ihn nicht verlassen, ihr Schatten ist ein anderer, ein
Vogel, eine Transformation, ein Zeichen eines anderen Bewußtseinszustandes,
womit er in eine andere Wirklichkeit verweist, in das Traumbewußtsein
oder sonstwohin, was mit dem augenblicklichen Dasein nichts zu tun hat.
Doch der Schatten ist aufdringlich, auch wenn er normalerweise nicht
gesehen wird. Wenn er sich in dieser Weise verändern würde,
wüssten wir als Betrachter sicher nicht mehr, wer wir eigentlich
sind. Wir sehen uns selbst nur in Teilen des Körpers, fast als
ganzes nur im Schatten, der zwar als Schein abgetan wird, aber genau
das Gegenteil davon ist. Schein und Schatten schließen einander
aus.
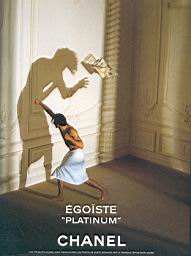 Im 20.
Jahrhundert blieb ein solches Interesse am Schatten die Ausnahme, da
er die raumzeitlichen Verbindungen der Wirklichkeit sichtbar macht,
für die sich die Moderne nicht interessierte. Doch zwingen nicht
die eingangs erwähnten kunsthistorischen Bücher, sondern Bildwerke
aus den letzten Jahren dazu, sich erneut mit dem Schatten zu beschäftigen. Im 20.
Jahrhundert blieb ein solches Interesse am Schatten die Ausnahme, da
er die raumzeitlichen Verbindungen der Wirklichkeit sichtbar macht,
für die sich die Moderne nicht interessierte. Doch zwingen nicht
die eingangs erwähnten kunsthistorischen Bücher, sondern Bildwerke
aus den letzten Jahren dazu, sich erneut mit dem Schatten zu beschäftigen.
Werbung für Egoiste PLATINUM von Chanel, 1994
Der Schatten ist keineswegs mehr in der Defensive gegenüber der
Wirklichkeit, wie in dieser Werbung für ein Duftwasser suggeriert
wird. Immerhin muß er imstande gewesen sein, die Flasche an sich
zu nehmen, die er in dieser Attacke des “Egoisten” wieder
verliert. Der Schatten ist mehr als nur der Mangel an Licht, er scheint
sogar stärker als die Wirklichkeit, wenn er dort wieder ersteht,
wo die Werke von ihren Sockeln verschwunden sind, wo die Simulation
sie zu ersetzen scheinen:
 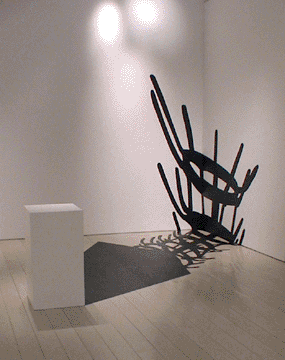
Regina Silveira: Meisterwerke (in Absentia), 1993
Die Künstlerin verweist darauf, dass auch nicht unmittelbar präsente
Werke ihre Schatten in die Gegenwart werfen, dass Marcel Duchamps Ready-made
Fahrradrad (1913) mehr ist, als nur die Erklärung zur Kunst, als
ein nobilitierender Sockel, auf den man Alltagsgegenstände postiert.
 Die
Russen Komar & Melamid lieferten mit dem Ursprung des sozialistischen
Realismus (1982-85, Abb. links) ein vorzügliches Beispiel,
weshalb man sich auch mit Vergleichsbeispielen aus der Kunstgeschichte
befassen muß. Die Muse geht formal und ikonografisch zurück
auf die Töpfertochter des Bildes Die Erfindung der Malerei
von Eduard Daege (1832), die den Schatten ihres Geliebten umreisst.
Der Diktator sitzt vor dem klassizistischen Pomp der Doppelsäule
und des roten Vorhangs, seine Hand an der Schulter der Muse verrät
etwas vom Zwang, während seine andere mit der Pfeife das Image
vom gemütlichen Väterchen betont. Aus der griechischen Kunst
kommt der unterwürfige Griff ans Kinn, und dass wegen der spiegelverkehrten
Wendung mit der Linken gezeichnet wird, ist doppelt kodiert, sowohl
als subversive Geste des Untergrunds wie der Abwertung des Gezeigten
zugleich. D.h. die Künstler deklarieren sich dadurch als Regimegegner,
obwohl sie Stalin als den Geliebten der mit der Linken Zeichnenden ins
Bild setzen, für den man sozialistisch-realistisch malt, und sie
werten dies zugleich subversiv ab, indem sie die “sinistre”,
die (linke) Schatten-Seite dieser auf Stalin zurückgehenden Kunst
demonstrieren. Die
Russen Komar & Melamid lieferten mit dem Ursprung des sozialistischen
Realismus (1982-85, Abb. links) ein vorzügliches Beispiel,
weshalb man sich auch mit Vergleichsbeispielen aus der Kunstgeschichte
befassen muß. Die Muse geht formal und ikonografisch zurück
auf die Töpfertochter des Bildes Die Erfindung der Malerei
von Eduard Daege (1832), die den Schatten ihres Geliebten umreisst.
Der Diktator sitzt vor dem klassizistischen Pomp der Doppelsäule
und des roten Vorhangs, seine Hand an der Schulter der Muse verrät
etwas vom Zwang, während seine andere mit der Pfeife das Image
vom gemütlichen Väterchen betont. Aus der griechischen Kunst
kommt der unterwürfige Griff ans Kinn, und dass wegen der spiegelverkehrten
Wendung mit der Linken gezeichnet wird, ist doppelt kodiert, sowohl
als subversive Geste des Untergrunds wie der Abwertung des Gezeigten
zugleich. D.h. die Künstler deklarieren sich dadurch als Regimegegner,
obwohl sie Stalin als den Geliebten der mit der Linken Zeichnenden ins
Bild setzen, für den man sozialistisch-realistisch malt, und sie
werten dies zugleich subversiv ab, indem sie die “sinistre”,
die (linke) Schatten-Seite dieser auf Stalin zurückgehenden Kunst
demonstrieren.
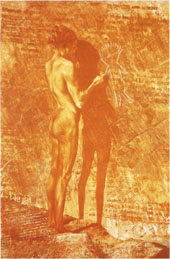 
Mark Tansey: a, 1990
Giorgio Vasari:
Der Ursprung der Malerei, 1573,
Casa Vasari Florenz
Auch dieses Bild des amerikanischen Künstlers Mark Tansey, dessen
Eltern übrigens Kunsthistoriker sind und der vielleicht aufgrund
dieser Schulung sich vieler Vorbilder entsinnt, übt durch die Überlagerung
von Zitaten einen sehr starken Druck auf jede Deutung aus. Nach einer
kurzen Beschreibung werde ich kursorisch die wesentlichsten Punkte zusammenfassen.
In dem gelben Bild zeichnet ein von hinten gesehener Ureinwohner in
einer (vermutlich platonischen) Höhle ein Strichmännchenn
an die Felswand, deren Struktur von einem Text gebildet wird. Tansey
bezieht sich auf eine andere Tradition vom Ursprung der Malerei, nämlich
auf den Künstler, der selbstverliebt seinen eigenen Schatten nachzeichnet,
wie wir es z.B. von Giorgio Vasari, dem Ahnherrn der Kunsthistoriker,
kennen.(Abb. oben rechts)

Vom Blickpunkt des Künstlers aus zeigt Claudio Parmiggiani
den konsequenten Schluss auf: Selbstporträt , 1979
Tansey: a (Abb.oben)
Aber es reicht nicht, auf derartige Vergleiche hinzuweisen, weil Tansey
gänzlich andere Interpretationshilfen liefert:
1) Der Künstler malt immer monochrom. Hier ist die Welt gelb. Das
bedeutet unter Hinweis auf Textstellen von Claude Levi-Strauss und Jean
Jaques Rousseau, dass das nicht die wirkliche Welt zeigt.
2) Wenn man den zugrundeliegenden dekonstruktivistischen Text des Freundes
und Schülers von Jaques Derrida, Paul de Man, Blindness and
Insight, (”Blindheit und Einsicht”) liest, wird man das
Geschehen verfehlen. Man kann nicht zugleich lesen und sehen.
3) Das Verhältnis der drei Realitätsebenen - Mann, Schatten
und Zeichnung - ist reduziert auf das am zentralen Punkt befindliche
Stäbchen. (Vgl. Abbildung im Text Die Allegorien
des Mark Tansey) Kommt man von den anderen Darstellungen des Ursprungs
der Malerei her, vermutet man, dass der Urmensch seinen Schatten nachzeichnet.
Aber jenseits, oder neben dem Schatten erscheint etwas ganz anderes.
Der Schatten steht nicht am Anfang, sondern zwischen Mensch und Kunst.
4) Im Kopf des Männchens steht vordergründig der erste Buchstabe
als Beginn des Alphabets, zugleich verneint das A diese These, es ist
als Alpha privativum der Hinweis auf die Nichtform, den Nichtlaut, die
Nicht-Schrift, auch die Nichtkunst, den Nichtursprung.
5) Daraus kann nur geschlossen werden, dass alle diesbezüglichen
Thesen unzuverlässig sind, weil vielleicht die Frage falsch ist.
Im Rahmen des platonischen Höhlengleichnisses durchschaut auch
der Urmensch in der Unterscheidung von Schatten und Kunst (Idee) keineswegs
die Täuschung, weil ihm kein Spiegel zur Verfügung steht,
in welchem er den Schein zu durchschauen vermöchte. Erst der Betrachter
hätte die Möglichkeit dazu. Doch der Betrachter sieht wiederum
nur die Täuschung eines mimetisch wirkenden Bildes. Wir müssen
intensiv recherchieren und reflektieren, um die Art der Darstellung
zu verstehen und die Art der ”Repräsentation” zu erkennen.
6) Diese Art des Schattens soll in die tiefe Vergangenheit verweisen,
aber sie hat etwas Irritierendes, weil es der Schatten im Licht ist,
nämlich der Schatten der hellsten Farbe Gelb. Die Monochromie zeigt
nicht nur, dass das nicht die wirkliche Welt ist, sondern auch noch
etwas im Sinne der Farbtheorie Erstaunliches.
Wenn man den Inhalt auf einen Punkt reduzieren wollte, geht es dabei
um die Veranschaulichung des undarstellbaren Ursprungs der Kunst, aber
auch der Sprache. Was am Anfang steht, läßt sich nicht zeigen.
Die Hand im Bild des Urmenschen ist auf den (undarstellbaren) Punkt
des Ursprungs der Gestaltung gerichtet. Diese Handhaltung ist nicht
Ausdruck des Urmenschen, vielmehr ist sie die Konkretisierung eines
dekonstruktivistischen Denkens, ein auf die Spitze getriebener Neokonzeptualismus,
wie man ihn selten in unseren Tagen findet.

Es gibt nicht nur Schatten in Bildern, sondern auch Schattenbilder.
Es sind vor allem Künstlerinnen, die sich dieses Mediums, das an
den biedermeirlichen Scherenschnitt erinnert, bedienen. Vor wenigen
Jahren wurde der Eiserne Vorhang der Wiener Staatsoper von einer
Künstlerin, Kara Walker, mit einem derartigen Schattenriss umgestaltet,
d.h. überdeckt.
Mein letztes Beispiel stammt von Rosemarie Trockel (Paare, 1998).
Leider verrät der   Katalog
der Wanderausstellung nichts über die Intention der Künstlerin,
die vom Computer isolierten Aktfotos von Liebesparen schwarz zu färben.
Die Körper werfen keine Schatten, sondern erscheinen wie unbunt-fleckenhafte
Ornamente. Die Abgründe dieser Darstellung offenbaren sich, wenn
man wiederum weit in die Geschichte zurückgreift, nicht unbedingt
zum Ursprung der Malerei, aber immerhin ins 18. Jahrhundert, als das
Zeichnen einer Silhouette (1778) von J. C. Lavater (Abb. rechts oben)
als physiognomisches Studium verharmlost eigentlich der Suche nach dem
sündenhaften Bösen galt, das sich im schattenhaften Umriss
der Menschen zeigte, was man zu Recht mit der Situation eines Beichtstuhls
verglichen hat. Schon damals hat Lavater im Widerspruch zur klassizistischen
Ästhetik Winckelmanns die vergötterte Gestalt des Apoll
vom Belvedere auf einen dunklen Kopf reduziert, d.h. in der Lichtgestalt
des Sonnengottes eine Art Luzifer aufgezeigt. Katalog
der Wanderausstellung nichts über die Intention der Künstlerin,
die vom Computer isolierten Aktfotos von Liebesparen schwarz zu färben.
Die Körper werfen keine Schatten, sondern erscheinen wie unbunt-fleckenhafte
Ornamente. Die Abgründe dieser Darstellung offenbaren sich, wenn
man wiederum weit in die Geschichte zurückgreift, nicht unbedingt
zum Ursprung der Malerei, aber immerhin ins 18. Jahrhundert, als das
Zeichnen einer Silhouette (1778) von J. C. Lavater (Abb. rechts oben)
als physiognomisches Studium verharmlost eigentlich der Suche nach dem
sündenhaften Bösen galt, das sich im schattenhaften Umriss
der Menschen zeigte, was man zu Recht mit der Situation eines Beichtstuhls
verglichen hat. Schon damals hat Lavater im Widerspruch zur klassizistischen
Ästhetik Winckelmanns die vergötterte Gestalt des Apoll
vom Belvedere auf einen dunklen Kopf reduziert, d.h. in der Lichtgestalt
des Sonnengottes eine Art Luzifer aufgezeigt.
 Verweist
man auf derartige Vorläufer (nicht unbedingt Vorbilder) heutiger
Kunstwerke, geht es nicht um Ableitungen oder gar Entwicklungslinien,
sondern um einen Wirklichkeitsbezug, der im Gegensatz zu früheren
Epochen nicht im perspektivischen Raum des Helldunkels konstruiert,
sondern als Thema der Erinnerung gesucht wird. Das reicht bis in die
politische Dimension, wie z.B. die Entwürfe für den Slowenischen
Tolar zeigen. In allen Schattenwürfen der letzten Jahre, von denen
ich nur ein paar ausgewählt habe, werden die Realität und
alte Identitätsvorstellungen in Frage gestellt. Verweist
man auf derartige Vorläufer (nicht unbedingt Vorbilder) heutiger
Kunstwerke, geht es nicht um Ableitungen oder gar Entwicklungslinien,
sondern um einen Wirklichkeitsbezug, der im Gegensatz zu früheren
Epochen nicht im perspektivischen Raum des Helldunkels konstruiert,
sondern als Thema der Erinnerung gesucht wird. Das reicht bis in die
politische Dimension, wie z.B. die Entwürfe für den Slowenischen
Tolar zeigen. In allen Schattenwürfen der letzten Jahre, von denen
ich nur ein paar ausgewählt habe, werden die Realität und
alte Identitätsvorstellungen in Frage gestellt.
Nachwort 2004:
Mittlerweile wird die Druckfassung des Vortrages im Kunsthistorischen
Jahrbuch Graz mit fünfjähriger Verzögerung angekündigt.
Das Thema mag in den vergangenen Jahren oft genug behandelt worden sein.
Es scheint aber seine Brisanz nicht allgemein bewußt zu sein.

Es mag ja sein, dass z.B. in Bildern von Pieter Janssens Elinga (1623-1682),
wie in dem Interieur mit Maler, lesender Dame und kehrender Magd
(s. Abb.) aus dem Städelschen Kunstinstitut, Frankfurt a.M.,
"ein in die Ecke gestellter, Schatten werfender Stuhl" zu
einem typischen Merkmal des Künstlers zählt. Naiv gefragt:
Wie vermag ein von außen in den Raum eingedrungener Lichtfleck
auf die Wand "zurückstrahlen" und so einen Schatten des
Stuhles werfen? Fast scheint es, als ob der Spiegel sein sanftes Licht auf den Stuhl-Schatten an der Wand unter
dem verschlossenen Fenster wirft und in der Folge der in der Ecke stehende
Stuhl entsteht. Wenn man genau hinsieht, bemerkt nicht nur einen Stuhl-Schatten,
sondern deren drei, obwohl das Licht nur ein Dreieck der Rückenlehne
beleuchtet. Die zwei Frauen wenden sich von diesem irrealen Schauspiel
ab, und der Maler im Hintergrund bemerkt von alledem - im Gegensatz
zu dem aufmerksamen Betrachter - nichts. Der zweite Stuhl im Dunkel
am vorderen rechten Bildrand scheint von dieser Lichtfolge dorthin geschoben
zu sein, sodass wir eine Art konzeptueller Folge von Stühlen haben,
wie wir sie seit Joseph Kosuths One and threee chairs (1965,
Abb. rechts) kennen.
Spiegel sein sanftes Licht auf den Stuhl-Schatten an der Wand unter
dem verschlossenen Fenster wirft und in der Folge der in der Ecke stehende
Stuhl entsteht. Wenn man genau hinsieht, bemerkt nicht nur einen Stuhl-Schatten,
sondern deren drei, obwohl das Licht nur ein Dreieck der Rückenlehne
beleuchtet. Die zwei Frauen wenden sich von diesem irrealen Schauspiel
ab, und der Maler im Hintergrund bemerkt von alledem - im Gegensatz
zu dem aufmerksamen Betrachter - nichts. Der zweite Stuhl im Dunkel
am vorderen rechten Bildrand scheint von dieser Lichtfolge dorthin geschoben
zu sein, sodass wir eine Art konzeptueller Folge von Stühlen haben,
wie wir sie seit Joseph Kosuths One and threee chairs (1965,
Abb. rechts) kennen.
Das Thema der Schattenspiele hält nach wie vor viele Überraschungen
bereit, die bis in die literarische Metaphorik reichen:
"Gleiten unsere Blicke nicht immerfort an den Anderen ab, wie
in der rasenden Begegnung des Nachts, und lassen uns zurück mit
lauter Mutmaßungen, Gedankensplittern und angedichteten Eigenschaften?
Ist es in Wahrheit nicht so, daß nicht die Menschen sich begegnen,
sondern die Schatten, die ihre Vorstellungen werfen?" (Pascal Mercier:
Nachtzug nach Lissabon. Carl Hanser Verlag, München - Wien
2004, S.116)
|





 Das
oft diskutierte Bild zeigt natürlich nicht die Szene aus dem 35.
Buch der Naturgeschichte des Plinius. Dort beschreibt der antike Autor
die Geschichte vom Ursprung der Malerei, wie die Tochter des Töpfers
Dibutades aus der Nähe von Korinth den Schatten ihres in die Fremde
ziehenden und nicht mehr zurückkehrenden Geliebten auf einer Wand
nachzeichnet. Murillo denkt zwar an derartige Geschichten, aber seine
Szene mit mehreren Männern findet im Freien statt. Ich verweise
nur auf zwei merkwürdige Umstände, erstens geben die Schatten
keine Haare, sondern nur die Kopfformen # wieder, zweitens wirft der
Gezeichnete zwei Schatten, als ob eine doppelte Lichtquelle auf ihn
fällt. Auf der Kartusche ist folgendes zu lesen: TUBO DE LA SOMBRA
ORIGEN LA QUE ADMIRAS HERMOSURA EN LA CELEBRE PINTURA (frei übersetzt:
Vom Schatten rührt die Schönheit her, die Du in dem berühmten
Gemälde bewunderst.) Dem Maler geht es offenbar darum, zu zeigen,
dass trotz der Brüchigkeit der ruinösen Hauswand die Schönheit
in dieser Welt des Schattens begründet liegt.
Das
oft diskutierte Bild zeigt natürlich nicht die Szene aus dem 35.
Buch der Naturgeschichte des Plinius. Dort beschreibt der antike Autor
die Geschichte vom Ursprung der Malerei, wie die Tochter des Töpfers
Dibutades aus der Nähe von Korinth den Schatten ihres in die Fremde
ziehenden und nicht mehr zurückkehrenden Geliebten auf einer Wand
nachzeichnet. Murillo denkt zwar an derartige Geschichten, aber seine
Szene mit mehreren Männern findet im Freien statt. Ich verweise
nur auf zwei merkwürdige Umstände, erstens geben die Schatten
keine Haare, sondern nur die Kopfformen # wieder, zweitens wirft der
Gezeichnete zwei Schatten, als ob eine doppelte Lichtquelle auf ihn
fällt. Auf der Kartusche ist folgendes zu lesen: TUBO DE LA SOMBRA
ORIGEN LA QUE ADMIRAS HERMOSURA EN LA CELEBRE PINTURA (frei übersetzt:
Vom Schatten rührt die Schönheit her, die Du in dem berühmten
Gemälde bewunderst.) Dem Maler geht es offenbar darum, zu zeigen,
dass trotz der Brüchigkeit der ruinösen Hauswand die Schönheit
in dieser Welt des Schattens begründet liegt.







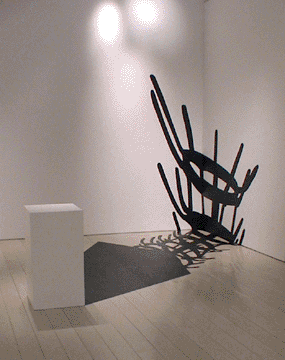
 Die
Russen Komar & Melamid lieferten mit dem Ursprung des sozialistischen
Realismus (1982-85, Abb. links) ein vorzügliches Beispiel,
weshalb man sich auch mit Vergleichsbeispielen aus der Kunstgeschichte
befassen muß. Die Muse geht formal und ikonografisch zurück
auf die Töpfertochter des Bildes Die Erfindung der Malerei
von Eduard Daege (1832), die den Schatten ihres Geliebten umreisst.
Der Diktator sitzt vor dem klassizistischen Pomp der Doppelsäule
und des roten Vorhangs, seine Hand an der Schulter der Muse verrät
etwas vom Zwang, während seine andere mit der Pfeife das Image
vom gemütlichen Väterchen betont. Aus der griechischen Kunst
kommt der unterwürfige Griff ans Kinn, und dass wegen der spiegelverkehrten
Wendung mit der Linken gezeichnet wird, ist doppelt kodiert, sowohl
als subversive Geste des Untergrunds wie der Abwertung des Gezeigten
zugleich. D.h. die Künstler deklarieren sich dadurch als Regimegegner,
obwohl sie Stalin als den Geliebten der mit der Linken Zeichnenden ins
Bild setzen, für den man sozialistisch-realistisch malt, und sie
werten dies zugleich subversiv ab, indem sie die “sinistre”,
die (linke) Schatten-Seite dieser auf Stalin zurückgehenden Kunst
demonstrieren.
Die
Russen Komar & Melamid lieferten mit dem Ursprung des sozialistischen
Realismus (1982-85, Abb. links) ein vorzügliches Beispiel,
weshalb man sich auch mit Vergleichsbeispielen aus der Kunstgeschichte
befassen muß. Die Muse geht formal und ikonografisch zurück
auf die Töpfertochter des Bildes Die Erfindung der Malerei
von Eduard Daege (1832), die den Schatten ihres Geliebten umreisst.
Der Diktator sitzt vor dem klassizistischen Pomp der Doppelsäule
und des roten Vorhangs, seine Hand an der Schulter der Muse verrät
etwas vom Zwang, während seine andere mit der Pfeife das Image
vom gemütlichen Väterchen betont. Aus der griechischen Kunst
kommt der unterwürfige Griff ans Kinn, und dass wegen der spiegelverkehrten
Wendung mit der Linken gezeichnet wird, ist doppelt kodiert, sowohl
als subversive Geste des Untergrunds wie der Abwertung des Gezeigten
zugleich. D.h. die Künstler deklarieren sich dadurch als Regimegegner,
obwohl sie Stalin als den Geliebten der mit der Linken Zeichnenden ins
Bild setzen, für den man sozialistisch-realistisch malt, und sie
werten dies zugleich subversiv ab, indem sie die “sinistre”,
die (linke) Schatten-Seite dieser auf Stalin zurückgehenden Kunst
demonstrieren. 



 Katalog
der Wanderausstellung nichts über die Intention der Künstlerin,
die vom Computer isolierten Aktfotos von Liebesparen schwarz zu färben.
Die Körper werfen keine Schatten, sondern erscheinen wie unbunt-fleckenhafte
Ornamente. Die Abgründe dieser Darstellung offenbaren sich, wenn
man wiederum weit in die Geschichte zurückgreift, nicht unbedingt
zum Ursprung der Malerei, aber immerhin ins 18. Jahrhundert, als das
Zeichnen einer Silhouette (1778) von J. C. Lavater (Abb. rechts oben)
als physiognomisches Studium verharmlost eigentlich der Suche nach dem
sündenhaften Bösen galt, das sich im schattenhaften Umriss
der Menschen zeigte, was man zu Recht mit der Situation eines Beichtstuhls
verglichen hat. Schon damals hat Lavater im Widerspruch zur klassizistischen
Ästhetik Winckelmanns die vergötterte Gestalt des Apoll
vom Belvedere auf einen dunklen Kopf reduziert, d.h. in der Lichtgestalt
des Sonnengottes eine Art Luzifer aufgezeigt.
Katalog
der Wanderausstellung nichts über die Intention der Künstlerin,
die vom Computer isolierten Aktfotos von Liebesparen schwarz zu färben.
Die Körper werfen keine Schatten, sondern erscheinen wie unbunt-fleckenhafte
Ornamente. Die Abgründe dieser Darstellung offenbaren sich, wenn
man wiederum weit in die Geschichte zurückgreift, nicht unbedingt
zum Ursprung der Malerei, aber immerhin ins 18. Jahrhundert, als das
Zeichnen einer Silhouette (1778) von J. C. Lavater (Abb. rechts oben)
als physiognomisches Studium verharmlost eigentlich der Suche nach dem
sündenhaften Bösen galt, das sich im schattenhaften Umriss
der Menschen zeigte, was man zu Recht mit der Situation eines Beichtstuhls
verglichen hat. Schon damals hat Lavater im Widerspruch zur klassizistischen
Ästhetik Winckelmanns die vergötterte Gestalt des Apoll
vom Belvedere auf einen dunklen Kopf reduziert, d.h. in der Lichtgestalt
des Sonnengottes eine Art Luzifer aufgezeigt. Verweist
man auf derartige Vorläufer (nicht unbedingt Vorbilder) heutiger
Kunstwerke, geht es nicht um Ableitungen oder gar Entwicklungslinien,
sondern um einen Wirklichkeitsbezug, der im Gegensatz zu früheren
Epochen nicht im perspektivischen Raum des Helldunkels konstruiert,
sondern als Thema der Erinnerung gesucht wird. Das reicht bis in die
politische Dimension, wie z.B. die Entwürfe für den Slowenischen
Tolar zeigen. In allen Schattenwürfen der letzten Jahre, von denen
ich nur ein paar ausgewählt habe, werden die Realität und
alte Identitätsvorstellungen in Frage gestellt.
Verweist
man auf derartige Vorläufer (nicht unbedingt Vorbilder) heutiger
Kunstwerke, geht es nicht um Ableitungen oder gar Entwicklungslinien,
sondern um einen Wirklichkeitsbezug, der im Gegensatz zu früheren
Epochen nicht im perspektivischen Raum des Helldunkels konstruiert,
sondern als Thema der Erinnerung gesucht wird. Das reicht bis in die
politische Dimension, wie z.B. die Entwürfe für den Slowenischen
Tolar zeigen. In allen Schattenwürfen der letzten Jahre, von denen
ich nur ein paar ausgewählt habe, werden die Realität und
alte Identitätsvorstellungen in Frage gestellt.
 Spiegel sein sanftes Licht auf den Stuhl-Schatten an der Wand unter
dem verschlossenen Fenster wirft und in der Folge der in der Ecke stehende
Stuhl entsteht. Wenn man genau hinsieht, bemerkt nicht nur einen Stuhl-Schatten,
sondern deren drei, obwohl das Licht nur ein Dreieck der Rückenlehne
beleuchtet. Die zwei Frauen wenden sich von diesem irrealen Schauspiel
ab, und der Maler im Hintergrund bemerkt von alledem - im Gegensatz
zu dem aufmerksamen Betrachter - nichts. Der zweite Stuhl im Dunkel
am vorderen rechten Bildrand scheint von dieser Lichtfolge dorthin geschoben
zu sein, sodass wir eine Art konzeptueller Folge von Stühlen haben,
wie wir sie seit Joseph Kosuths One and threee chairs (1965,
Abb. rechts) kennen.
Spiegel sein sanftes Licht auf den Stuhl-Schatten an der Wand unter
dem verschlossenen Fenster wirft und in der Folge der in der Ecke stehende
Stuhl entsteht. Wenn man genau hinsieht, bemerkt nicht nur einen Stuhl-Schatten,
sondern deren drei, obwohl das Licht nur ein Dreieck der Rückenlehne
beleuchtet. Die zwei Frauen wenden sich von diesem irrealen Schauspiel
ab, und der Maler im Hintergrund bemerkt von alledem - im Gegensatz
zu dem aufmerksamen Betrachter - nichts. Der zweite Stuhl im Dunkel
am vorderen rechten Bildrand scheint von dieser Lichtfolge dorthin geschoben
zu sein, sodass wir eine Art konzeptueller Folge von Stühlen haben,
wie wir sie seit Joseph Kosuths One and threee chairs (1965,
Abb. rechts) kennen.